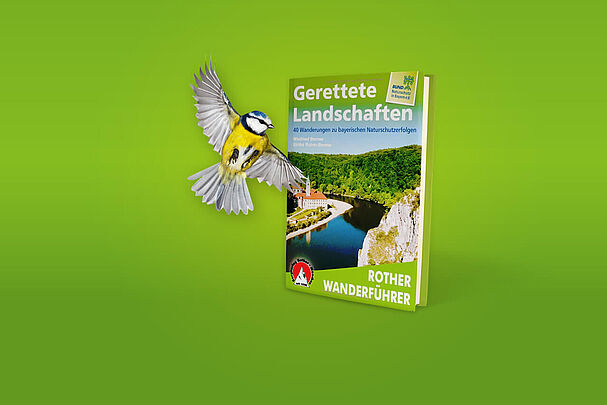Sandharlandener Heide: Wiederbelebung extensiver Weidewirtschaft
Wird naturnahe Nutzung aufgegeben, droht vielfach die Artenvielfalt zu verarmen. Stark wechselnde Bodenverhältnisse machten eine Weide in der Nähe von Kelheim besonders schutzbedürftig: Durch Kauf und Pflege sowie Engagement für die gemeinschaftliche Bewirtschaftung konnte der BN den ursprünglichen Artenreichtum wieder herstellen und erhalten – seit den 1960er-Jahren wissenschaftlich begleitet.

"Auf dem Rummel Hutung": So ist die Flur im Grundbuch bezeichnet, die der BUND Naturschutz in Bayern e. V. (BN) ab 1962 Stück für Stück kaufte. Weideland also, mit all dem Gerenne und Gehüpfe, mit dem Blöken von Schafen und dem Meckern von Ziegen, wenn sie zusammen mit Rindern und Pferden aus den verschiedenen Bauernhöfen auf die Allmende getrieben wurden.
Diese jahrhundertelange Weidewirtschaft und der trockene Boden, teils kalkig aus der Jurazeit, teils sandig, herangeweht nach der letzten Eiszeit, ließen eine überraschende Nachbarschaft von gegensätzlichen Pflanzengesellschaften entstehen. Da wachsen Frühlingsenzian und Silberdistel, die Kalkboden lieben, gleich neben Heidekraut und Flügelginster, die Sand bevorzugen.
Große Artenvielfalt in der Sandharlander Heide durch Nutzungsaufgabe bedroht
Über 240 Pflanzenarten finden wir hier, darunter viele gefährdete und bedrohte Arten, ebenso wie alles, was dazwischen springt, kriecht oder fliegt, wie seltene Heuschreckenarten, Wildbienen, Falter, Eidechsen, Schlingnattern oder Neuntöter: Die Heidelerche brütet in ihrem Bodennest, ungestört von Mähwerken und Gülle.
Was heute so aussieht, als wäre es nie anders gewesen, kam um die Mitte des letzten Jahrhunderts in Gefahr. Die Weidewirtschaft lohnte sich nicht mehr und wurde eingestellt. Kiefern wuchsen und der Rasen verfilzte ohne die "Pflege" durch hungrige Tiermäuler. Durchsetzungsschwache Arten wurden verdrängt, die äußerst seltene Frühlings-Küchenschelle verschwand fast ganz von der Fläche.
Die Naturschützer vom BN erkannten den besonderen Wert des Ödlands, das zu einem Mosaik aus unterschiedlichen Sandlebensräumen mit Binnendünen, Sandkiefernwäldern und Sandrasen rund um Abensberg gehört. Es wurde 1970 unter Naturschutz gestellt und vom BN betreut. 1984 übernahm es der Kelheimer Landschaftspflegeverband VöF, eine Kooperation von BN und Landkreis Kelheim, die Pflege und Entwicklung der Sandharlander Heide systematisch zu planen.
Mit Geld aus der Verbandskasse und Fördermitteln aus dem Bayerischen Naturschutzfonds konnte das Schutzgebiet von elf auf 25 Hektar erweitert werden, gesät wurde Heublumensaat aus der Heide. Einer Spezialgärtnerei gelang es sogar, die Frühlings-Küchenschelle aus den Samen der letzten vorhandenen Pflanzen in der Heide wieder zu vermehren.
Schutz der Sandharlandener Heide als Gemeinschaftsprojekt
Gefährdet ist die wieder erstandene Heide heute nicht mehr. Der Landschaftspflegeverband VöF, die Kommunen und die Bauern bewahren hier gemeinsam unsere Heimat. Das Altmühltaler Lamm, eine der alten Haustierrassen, übernimmt dabei einen wichtigen Teil der Pflege. Die umliegenden Felder werden von den Bauern ohne Pflanzenschutzmittel und mit nur wenig Dünger bewirtschaftet, um einen Eintrag in die empfindliche Heide zu verhindern. Die Böden hagern aus, und so leuchten aus den Äckern Klatschmohn und Kornblume, aber auch der Ackerrittersporn, der sonst kaum noch zu finden ist.
Wissenschaftler begleiteten das Projekt von Anfang an. Freiwillige Helfer der BN-Kreisgruppe Kelheim beobachten Veränderungen in der Heide und unterstützen die bisherige Entwicklung. Ihr langjähriger Vorsitzender Peter Forstner aber sorgt sich nicht nur um die Pflanzen und Tiere der Heide. Sein wichtigstes Anliegen ist es, die Menschen vor Ort für ihre Heide zu begeistern. Als ausgebildeter Natur- und Landschaftsführer bringt er vor allem Kindern "das Reich von Ameisenlöwe und Ziegenmelker" nahe.