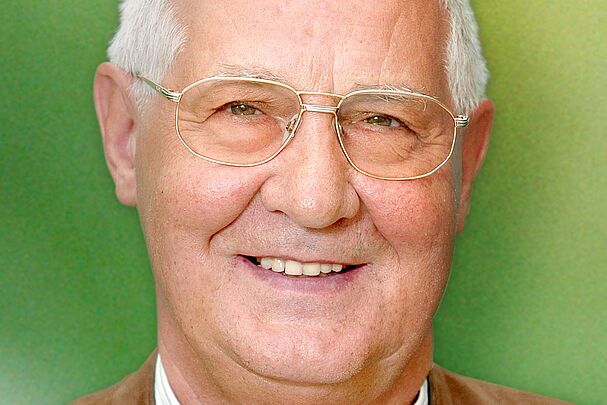Nationalpark Bayerischer Wald: Wo Natur Natur sein darf
Es war ein großer Erfolg, gerade auch für den BUND Naturschutz: Am 17. Oktober 1970 wurde im Bayerischen Wald auf 13.500 Hektar der erste Nationalpark Deutschlands eröffnet. Und 1997 folgte der zweite Triumph: Der Nationalpark wurde auf 24.300 Hektar erweitert.

Erster Nationalpark Deutschlands
1970 wird im Bayerischen Wald auf 13.500 Hektar der erste deutsche Nationalpark eröffnet. 1997 erfolgt eine Erweiterung auf 24.300 Hektar. Mit dem Großschutzgebiet setzt der BUND Naturschutz (BN) einen Meilenstein im deutschen Naturschutz.
Natur Natur sein lassen
Im Nationalpark Bayrischer Wald gilt die Devise „Natur Natur sein lassen“. Auch nach Windwurf oder bei Borkenkäfer-Befall wird nicht eingegriffen, um die natürlichen Prozesse im Wald nicht zu stören. Das Ziel: eine urwaldähnliche Wildnis. Bis zum Jahr 2027 sollen 75 Prozent der Nationalparkfläche als Naturzone ausgewiesen sein.
Ein Hotspot der Biodiversität
Der Nationalpark ist ein Refugium für seltene Tiere wie Luchs, Fischotter, Auerhuhn oder Habichtskauz — manche Arten kehren nach Jahrzehnten zurück. Eine große Vielfalt an Tieren, Pflanzen und Pilzen macht das Schutzgebiet zu einem Hotspot der Biodiversität. Schätzungsweise 14.000 Arten gibt es im Nationalpark Bayerischer Wald.
Meinung hat sich gedreht
Die unaufgeräumte Natur provozierte Ablehnung: Viele fürchteten „verwilderte“ Wälder und lehnten die Erweiterung ab. Mit der Zeit stieg die Akzeptanz — heute sehen über 80 Prozent der Einheimischen den Nationalpark positiv.
Die Nationalpark-Philosophie: Natur Natur sein lassen
Der Nationalpark Bayerischer Wald ist der älteste Nationalpark Deutschlands. Seine Geschichte ist auch eine Erfolgsgeschichte des BUND Naturschutz. Denn den Anstoß zur Gründung des Parks gaben in den Sechzigerjahren der berühmte Naturfilmer Bernhard Grzimek und der langjährige BN-Vorsitzende Hubert Weinzierl. Sie überzeugten die Staatsregierung und 1970 wurde der Traum eines Nationalparks in Deutschland Wirklichkeit.
Bis heute setzt sich der BUND Naturschutz immer wieder für die entstehende Waldwildnis im Nationalpark ein. Längst ist der Nationalpark auch ein Touristenmagnet geworden und zusammen mit dem Nationalpark Šumava auf tschechischer Seite bildet er das größte geschlossene Waldgebiet Mitteleuropas. Luchs und Auerhuhn, Fischotter und Habichtskauz, ja sogar vereinzelte Elche und Wölfe finden hier eines ihrer letzten Refugien in Mitteleuropa.
Der langjährige Chronist der Nationalparksgeschichte, der Künstler Herbert Pöhnl, argumentiert so: "Der Nationalpark muss sich nicht rechtfertigen, nur weil er seine Aufgaben erfüllt und eine Wirklichkeit schafft, die anders ausgerichtet ist als die nutzungs- und schönheitsorientierte." Oder, wie der Journalist Hannes Burger schrieb: "Es gilt heute, die Natur zu verstehen und sie als Wert ohne materiellen Nutzen zu akzeptieren."
“Natur Natur sein lassen”, das war die neue Formel, die Hans Bibelriether ausgab. Er leitete von 1979 bis 1998 die Nationalparkverwaltung. Die Nationalparkgeschichte war damit auch eine Geschichte der Philosophie des Naturschutzes und des Umgangs des Menschen mit der Natur insgesamt. Als der Nationalpark eingeweiht wurde, war hierzulande niemandem so richtig klar gewesen, was das eigentlich ist. Mit dem neuen Grundsatz, wurde das Wesen eines Nationaparks greifbarer.
Was die neue Philosophie konkret bedeutet, sorgte und sorgt teilweise noch heute bei manchen Menschen für Missstimmung: Wind- und Schneebrüche werden nicht mehr ausgeräumt, der Borkenkäfer wird in der Naturzone nicht bekämpft. Im Jahr 2027 sollen 75 Prozent der Nationalparkfläche als Naturzone ausgewiesen sein, in der Natur Natur sein darf.
Längst zeigt sich, dass der Wald den Menschen tatsächlich nicht braucht. Wo er darf, regeneriert er sich von ganz allein. Die kommenden Generationen werden einen ganz anderen, deutlich naturnäheren Wald erleben dürfen als den Kulturwald, wie wir ihn heute kennen. Diese Entwicklung ist das Ergebnis engagierten Naturschutzes.
Die Natur hilft sich selbst

Bibelriethers Ansatz war: Geschützt werden muss die natürliche Entwicklung von Ökosystemen, die Kraft der Evolution. Bis zum Beginn der 1970er-Jahre hieß Naturschutz Arten- und Biotopschutz – und das verstand sich inklusive menschlicher Eingriffe, Hege und Pflege. Da galt Windbruch als Katastrophe und Schädlingsbefall musste bekämpft werden. Anders Raumschutz statt Artenschutz. Oder, um es mit dem Schriftsteller Harald Grill zu sagen, einem großen Kenner des Bayerischen Waldes: „Niemand kann genau sagen, wie es weitergeht.“ Und genau darum geht es: Etwas aus menschlicher Beherrschung entlassen. Das Ziel ist und bleiben laut Franz Leibl, Leiter des Nationalparks von 2011 bis 2023: urwaldähnliche Waldstrukturen.
Windwurf als Chance für einen Neubeginn
Das Erkennen der Selbstgestaltungskraft der Natur begann im Jahr 1972. Damals hatte ein Sturm im Nationalpark rund 3.000 Fichten umgerissen. Gegen viele Widerstände – vor allem der Forstämter – blieben einige Dutzend Bäume liegen. Ein Windwurf, der schon zehn Jahre danach den Grundstock gebildet hatte für einen naturnahen und stabilen Jungwald, der sich völlig ohne menschliches Zutun, ohne irgendwelche Pflanzungen entwickelte: artenreich, differenziert, mit Wachstumschancen für neue Pflanzen, Ansiedlungschancen für neue Tierarten.
Bald zeigte sich: Die Natur regeneriert sich selbst. Als im Jahr 1983 ein weiterer Gewittersturm über der Region wütete, blieben in der damals 6.500 Hektar großen Kernzone des Naturparks Windwürfe liegen. Und auf die Vitalität der Natur war Verlass. Sie hilft sich selbst, wenn der Mensch sie nicht nutzt, nicht gestalterisch eingreift. Nur beim Wildbestand gibt es Ausnahmen: Hirsche werden weiterhin geschossen, um dem Jungwald angesichts des ansonsten zu starken Wildverbisses eine Chance zu geben. Die Rehjagd hingegen hat bereits der Luchs wieder übernommen.
Es gibt Tiere, die den Schritt hin zu mehr Wildnis, mehr Urwaldähnlichkeit anzeigen. Tiere wie der Habichtskauz, die als Urwaldreliktart ein guter Anzeiger echter Wildnis ist. Denn genau dieser Vogel findet sich in den Neuwald-Arealen und profitiert von ihnen. Man zählt derzeit 50 Brutpaare im Bayerischen Wald und in benachbarten tschechischen Waldgebieten.
Borkenkäfer als “natürlicher Förster”
Heute ist der Nationalpark ein einmaliges Highlight der biologischen Vielfalt. Trotz gesellschaftspolitischer Hürden, die zu überwinden waren, zahlreicher Kompromisse und Widerstände gegen das Ziel „Natur Natur sein lassen“. Der Mut zum Nichtstun und ohne lenkende Eingriffe des Menschen den natürlichen Prozessen freien Lauf zu lassen, ist für die Bewahrung der Arten- und Lebensraumvielfalt in der heutigen Zeit wichtiger denn je.
Naturereignisse wie Windwurf oder Schneebruch sind zusammen mit Insekten- und Pilzbefall wesentliche Faktoren der natürlichen Waldentwicklung in einem Nationalpark. Und gerade der Borkenkäfer hat sich als eine Schlüsselart dieser dynamischen Prozesse des Waldumbaus sowie für die darauf angewiesenen seltenen und gefährdeten Arten erwiesen. Die Naturzonen und damit die Wildnisentwicklungsflächen müssen deshalb auch im Erweiterungsgebiet des Nationalparks so schnell wie möglich vergrößert werden.
Zwischen Akzeptanz und Widerstand

“Aufräumen” oder sich selbst überlassen? Was den Nationalpark anbelangt, treffen zwei völlig unterschiedliche Naturphilosophien aufeinander. Das zeigt vor allem im Widerstand gegen die Erweiterung im Jahr 1997. Braucht der Wald den Menschen? Kann man ihn sich selbst überlassen? Ist es nicht „unser“ Wald, den wir gestalten müssen?
Die einen verspüren den Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, die anderen, sie nach menschlichen Maßstäben zu gestalten. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die sich einen dynamischen, wilden Wald wünschen, auf der anderen Seite die Anhänger*innen eines geordneten Försterwalds. Was für die einen Natur ist, die sich selbst überlassen wird, ist für die anderen ein "Saustall": Natur soll dem Schönheitsempfinden des Menschen entsprechen und aufgeräumt sein.
Angst vor Veränderung
Die Gegner*innen der Erweiterung fürchteten ein Absterben des gesamten Waldes und kritisierten das eingeschränkte Betretungsrecht. Sie störten sich vor allem an der „Tatenlosigkeit“ der Nationalparkverwaltung dem Borkenkäfer gegenüber. Vor allem in der Gegend des Erweiterungsgebiets um den Falkenstein regte sich 1997 großer Widerstand.
Die Naturschützer*innen seien die "Totengräber des Bayerwalds", so die Erweiterungsgegner. Die ungeheure Dynamik und die ungewohnten, teils erschreckenden Waldbilder, die sich im alten Nationalparkgebiet zeigten, lösten Ängste um die Zukunft der Heimat aus. 1995 gab es in Zwiesel eine große Demonstration gegen die Vergrößerung des Nationalparks, bei einem Bürgerentscheid in Frauenau im April 1996 lehnten 74 Prozent die Erweiterung ab.
Jugend stärker vom Naturschutzgedanken geprägt
Die Jüngeren standen dem Nationalpark offener gegenüber als die Älteren. Eine Studie zeigte, dass es sich bei den Diskussionen rund um den Nationalpark auch um eine Generationenfrage handelte. Die Jungen wuchsen mit dem Nationalpark auf, waren stärker vom Naturschutzgedanken geprägt und zeigten für den Prozessschutz deutlich mehr Verständnis. Der Widerstand der älteren Menschen machte sich an einem seit Generationen gewohnten Waldbild fest, das ein statisches war. Ein Wald aber verändert sich kontinuierlich.
In der Debatte gründeten sich Vereine der Nationalpark-Gegner*innen und der Nationalpark-Befürworter*innen. Auch viele Politiker*innen positionierten sich auf dieser oder jener Seite. Zu den Befürworter*innen zählten beispielsweise Alois Glück, Hans Eisenmann, Edmund Stoiber und Karl Bayer. Zu den Gegner*innen Franz Handlos, Alois Kandlbinder und Michael Adam.
Giraffen und Elefanten
Der Widerstand ging gelegentlich auch seltsame bis kriminelle Wege. Immer mal wieder machten in der Vergangenheit Gerüchte die Runde. Unter anderem wurde lange kolportiert, auf Bernhard Grzimeks Geheiß, der zu den Unterstützer*innen der Nationalparkidee gehörte, sei geplant, Giraffen und Elefanten anzusiedeln. Auch gab es illegale Baumpflanzaktionen in den Kernzonen des Parks. Auch Wilderei und Jagdfrevel kamen vor.
Auch gegen den Luchs regte sich teils vehementer Widerstand vor allem auf Seiten der Jägerschaft. Sie sehen die Luchse als jagende Konkurrenz an. Der Protest nimmt teils widerwärtige Formen an. So wurden 2015 in der Gegend von Lam provokativ die abgeschnittenen Pfoten von gewilderten Luchsen ausgelegt.
Akzeptanz ist gestiegen
Die Mehrheit der örtlichen Bevölkerung sieht den Nationalpark mit seiner dynamischen Waldentwicklung mittlerweile positiv. Ergebnisse eines sozioökonomischen Monitorings der Universität für Bodenkultur Wien zeigen, dass mehr als 80 Prozent der befragten Einheimischen der Aussage zustimmen, dass der Nationalpark Bayerischer Wald die Lebensqualität in der Region erhöht. Im Nationalpark-Altgebiet liegt die Zustimmung bei über 90 Prozent. Im Erweiterungsgebiet, gegen das es 1997 noch heftigen Widerstand und Demonstrationen gab, waren es rund 20 Jahre später über 80 Prozent.
Pilze, Pflanzen und Tiere im Bayerischen Wald

Es ist der Nicht-Urwald, der Fichtenwald, den manche Menschen verteidigen wollen, die sich für ein kontinuierliches Ausräumen der Wälder nach Borkenkäferbefall aussprechen. Der Borkenkäfer aber räumt den Wald nur um, zerstört ihn nicht – und sorgt für Artenvielfalt. Eine Zählung im November 2011 ergab 3.849 Tierarten, 1.861 Pilzarten, 489 Moosarten, 344 Flechtenarten, 757 Gefäßpflanzenarten. Nach einer Hochrechnung gibt es wohl 14.000 Arten im Nationalpark Bayerischer Wald.
3.849
Arten
Tiere
757
Arten
Gefäßpflanzen
1.861
Arten
Pilze
Typisch für den Bayerischen Wald sind unter anderem die natürlichen Fichtenwälder der Bergkämme und Hochplateaus, die den Taigawäldern des Nordens verwandt und durchsetzt sind mit typischen Bodenpflanzen wie Gebirgsfrauenfarn, Berg-Soldanelle, Heidelbeere, Reitgras und Hainsimse. Charakteristisch sind auch die Hochmoore mit Rentierflechte, Moorbärlapp und fleischfressenden Pflanzen wie dem Sonnentau. Wichtig ist auch der – sich regenerierende – Bergmischwald, der seltenere Baumarten umfasst, so etwa Spitzahorn, Ulme, Linde, Esche und Eibe.
Pflanzen auf Wiesen, an Bächen und Seen
In den Wäldern dominieren Moose und Farne. Auf Wiesen sind Pflanzen zu finden wie Arnika, Pechnelke, Glockenblume, Borstgras, Knabenkraut, Wollgras, Frühlingsknotenblume. Wiederum ganz eigene Vegetation wächst an den Bächen und Seen: Österreichische Gemswurz, Alpenmilchlattich, Eisenhut, Waldgeißbart, Bitteres Schaumkraut, Pestwurz, Sumpfdotterblume.
Tiere der Region
Typische Tiere der Region sind Fischotter, Rothirsch, Wildschwein, Braunbär, Wildkatze, Wolf, Baummarder, Habichts- und Raufußkauz, Auer- und Haselhuhn, Schwarzstorch und Spechtarten wie Weißrücken- und Dreizehenspecht. Bären gibt es in freier Wildbahn nicht mehr beziehungsweise noch nicht wieder. Vereinzelte Wölfe durchstreifen das Gebiet aber schon seit Jahren immer wieder, bis sie weiterziehen.

Ein Symboltier und kennzeichnend für Bayerwald und Böhmerwald ist der Luchs. Im Monitoringjahr 2023/2024 registrierte das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) 95 Luchse in Bayerns Wäldern. Der Art gilt besondere Aufmerksamkeit, ebenso wie den Habichtskäuzen, von denen 50 Brutpaare im Bayerischen Wald und in benachbarten tschechischen Brutrevieren leben, sowie der Auerhahnpopulation. Im Zentrum des Interesses stehen aber nicht einzelne Arten, sondern deren Gesamtheit, Zusammenspiel wie auch Wildheit und Rätselhaftigkeit.
Nach langer Zeit wiederentdeckt
Dass und wie sich Natur erholen kann, beweist die Zahl der im Nationalpark im Jahr 2014 gefundenen Arten, die erstmals nachgewiesen, nach langer Zeit wiederentdeckt und an neuen Fundorten belegt werden konnten. Da sind die Waldbirkenmaus, der Weißrückenspecht, die Schlingnatter, die Alpine Gebirgsschrecke, Reitters Rindenkäfer, die Gewöhnliche Natternzunge, die Ästige und die Gewöhnliche Mondraute, der Gewöhnliche und Isslers Flachbärlapp und Brauns Schildfarn.