- Home ›
- Themen ›
- Ökologisch leben ›
- Naturgarten ›
- Lebensraum Garten
Lebensraum Garten – Artenvielfalt im Garten fördern
Wer Artenschwund und Insektensterben entgegenwirken möchte, kann schon im eigenen Garten viel tun. Besonders wichtig ist es, verschiedene Strukturen zu schaffen. Je vielgestaltiger ein Garten ist, desto mehr verschiedene Pflanzen und Tiere fühlen sich wohl, finden Nahrung und Unterschlupf. Außerdem ist ein Naturgarten eine Wohlfühloase für uns Menschen.
Die fünf Elemente des Naturgartens
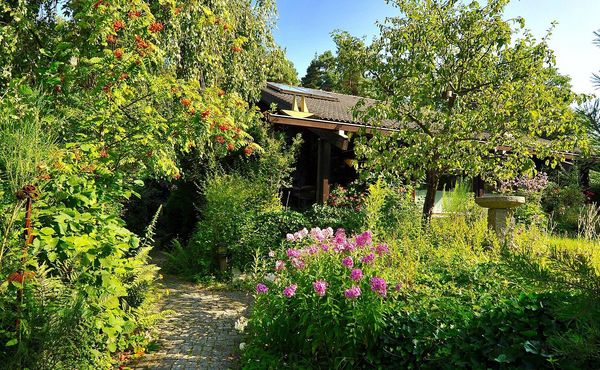
Ein Naturgarten setzt sich im Wesentlichen aus vier strukturellen Elementen zusammen:
- einer artenreichen Wildblumenwiese oder Blühfläche,
- einem Staudenbeet,
- einem Bestand aus heimischen Sträuchern,
- bei ausreichendem Platzangebot aus heimischen Laubbäumen.
Das fünfte Element: der Verzicht auf Gartengifte
Damit der Garten ein echter Lebensraum für viele Tiere wird, gilt es, vollständig auf chemische Pflanzenschutzmittel und Unkrautvernichter zu verzichten. Diese Gifte sind nämlich nicht nur für “Schädlinge” und “Unkräuter” tödlich, sondern haben oft auch für “Nützlinge” wie Bienen fatale Folgen. Man kann “Schädlingen” und “Unkräutern” auch auf natürliche Weise beikommen:
Wildblumenwiese und Wildblumenbeet

Beim Kauf der Wildblumensamen sollte man darauf achten, dass es sich um eine möglichst blütenreiche Mischung aus heimischen Wildblumenarten handelt. Eine Vielfalt an Samen kann im Gartenfachhandel bestellt werden.
Gute Beispiele für Wildblumen
- Bitterkraut
- Bunte Kronwicke
- Dost (Wilder Majoran)
- Einjähriges Silberblatt
- Gemeine Kratzdistel
- Glockenblume
- Herzgespann
- Hornklee
- Kornblume (Wildform)
- Nachtviole
- Natternkopf
- Quirlblütiger Salbei
- Skabiosen-Flockenblume
- Teufelsabbiss
- Tauben-Skabiose
- Steinklee
- Wegwarte
- Wiesensalbei
- Wiesenflockenblume
- Wilde Karde
- Wilder Thymian
- Witwenblume
Wichtige Raupenpflanzen
- Ackersenf
- Barbarakraut
- Brennnessel
- Borretsch
- Bunte Kronwicke
- Färberwaid
- Gemeiner Hohlzahn
- Hornklee
- Hufeisenklee
- Kratzdistel
- Kohldistel
- Wiesen-Labkraut
- Echtes Labkraut
- Nachtviole
- Pfefferminze
- Roßminze
- Einjähriges Silberblatt
- Wilde Möhre
- Raues Veilchen
- Wald-Veilchen
Staudenbeete

Ein Staudenbeet ist prima für Bienen und Hummeln, macht kaum Arbeit und blüht fast das ganze Jahr über. Gerade im Sommer bietet ein Kräuterbeet mit Gewürz- und Duftsträuchern der Familie der Lippenblütler Hummeln und Bienen Nektar und Pollen.
- Blauer Ysop
- Färberkamille
- Fingerhut
- Glockenblume
- Karthäusernelke
- Königskerze
- Lavendel
- Majoran
- Mohn
- Rosmarin
- Salbei
- Thymian
- Verbene
- Weidenblütiges Ochsenauge
- Wiesenraute
So pflegt man einen Staudengarten
- Lassen Sie jeder Staude ausreichend Platz, damit sie sich ihrer Wuchsform entsprechend entwickeln kann.
- Keinen Rindenmulch verwenden! Die Gerbstoffe der Rinde wirken wachstumshemmend. Besser ist Grünschnitt, Laub, Kompost oder Kies.
- Im ersten Jahr keine Beikräuter dulden, damit sich die Stauden gut entwickeln können.
- Rückschnitt nach der Blüte, um ein Versamen zu verhindern bzw. um zu erneuter Blüte anzuregen und die Bestockung zu fördern.
- Je älter die Staudenpflanzung, desto geringer wird der Pflegeaufwand. Die Stauden sollten mit der Zeit eine geschlossene Pflanzendecke ergeben, die sich zwar verändert, im Großen und Ganzen aber selbst reguliert.
- Vitalität fördern: Teilen und verpflanzen von alten, innen verkahlenden Pflanzenhorsten.
- Kranke Pflanzenteile zurückschneiden, um eine rasche Regeneration zu ermöglichen und eine Übertragung auf Nachbarpflanzen zu vermeiden.
- Wenn überhaupt, mit gut abgelagertem Kompost düngen. Den trägt man als Mulchschicht um die Pflanzen herum auf. Die Pflanzen dürfen keinesfalls darin vergraben werden - das fördert Fäulnis. Mineralische Dünger sind nicht notwendig.
- Zuerst beobachten und erst dann ggf. düngen. Viele Stauden, die natürlicherweise auf nährstoffarmen, oft trockenen Standorten vorkommen, reagieren auf ein Zuviel an Nährstoffen häufig mit übermäßigem Wachstum und verkürzter Lebensdauer.
- Auf keinen Fall im Herbst generell zurückschneiden! Manche Stauden werden dadurch frostempfindlicher. Viele Insekten nutzen trockene Stängel als Überwinterungsmöglichkeit, und Sie bringen auch sich selbst um schöne Herbst- und Winteraspekte, wenn Sie alles dem Erdboden gleichmachen.
- Diese und weitere Tipps finden Sie auch beim Netzwerk blühende Landschaft
Zwiebel- und Knollenpflanzen

Um die Blütenvielfalt zum Jahresbeginn zu vergrößern, empfiehlt sich das Setzen von Zwiebel- und Knollenpflanzen – zur Ergänzung der Aussaat. Manche wie Krokus und Schneeglöckchen sind als Frühlingsboten wohlbekannt, andere wie Schnittlauch und Bärlauch können auch unseren Speiseplan erweitern. Die Zwiebeln sollten vor dem ersten Frost im Herbst ausreichend tief gepflanzt werden. Zwiebelgewächse eignen sich übrigens auch für Dachbegrünungen.
- Anemone
- Bärlauch
- Blaustern
- Buschwindröschen
- Dichternarzisse
- Krokus
- Lerchensporn
- Milchstern
- Narzisse
- Schachbrettblume
- Schneeglöckchen
- Schnittlauch
- Traubenhyazinthe
- Winterlinge
- Weinbergtulpe
- Wildtulpe
Licht aus im Garten!
Tiere und Pflanzen brauchen die Nacht
Die Lebensweise vieler Tiere und Pflanzen wird wesentlich durch den natürlichen Wechsel von Tag und Nacht bestimmt. Viele Tiere, zum Beispiel 60 Prozent aller Insektenarten, sind dämmerungs- oder nachtaktiv. Das künstliche Erhellen des Nachthimmels oder direkte Anstrahlen ihrer Lebensräume schadet den Tieren. Insekten können so ihrer Bestäuberleistung nicht mehr nachkommen. Die Folge: Die Artenvielfalt sinkt! Auch Pflanzen kann künstliches Licht irritieren und sie zur falschen Jahreszeit blühen lassen.
Bitte verzichten Sie deshalb auf künstliche Lichtquellen im Garten – und genießen Sie den natürlichen Zauber der Nacht!
Welche Flächen eignen sich für Zwiebel- und Knollenpflanzen?
- Nur Flächen, die nicht umgegraben, gefräst oder gleich nach der Blüte gemäht werden, eignen sich. Also auch keine Aussaatflächen für einjährige Blühmischungen, es sei denn die Zwiebeln werden nach der Blüte rausgenommen und im Herbst wieder eingesetzt.
- Zwiebeln möglichst gruppenweise pflanzen, wenn eine Grasfläche dennoch kurz gehalten werden muss. Dann kann man um die Zwiebelgewächse herum mähen.
- Zwiebeln und Knollen mögen keine Staunässe, da die ständige Feuchte zur Fäulnis führt.
- Besonders geeignet für den naturnahen Hausgarten sind verwildernde Arten, die sich dann auch über größere Flächen verteilen können.
Wie pflanze und pflege ich Zwiebeln und Knollen?
- Die Blumenzwiebeln ausreichend tief pflanzen, mindestens doppelte Zwiebelgröße tief.
- Zeitpunkt: Vor dem ersten Frost, aber nicht zu spät im Herbst pflanzen.
- Bei horstbildenen Zwiebel- und Knollenarten kann im Herbst eine Teilung erfolgen, wenn Sie im Vorjahr zu dicht standen.
- Zwiebelsamen nach der Blüte absammeln und wieder aussäen.
- Frühestens sechs Wochen nach der Blüte die oberirdischen Pflanzenteile abschneiden. Sonst können die Zwiebeln nicht genügend Nährstoffe aus den Blättern in die Knolle zurückziehen. Als Folge kommen die Pflanzen im nächsten Frühjahr nur schwachwüchsig oder gar nicht.
- Diese und weitere Tipps finden Sie auch beim Netzwerk blühende Landschaft
Wildsträucherhecke

Viele heimische Sträucher bieten Futter für Insekten und Vögel. Eine Wildsträucherhecke ist bunter und abwechslungsreicher als eine langweilige, dauergrüne Thujamauer, in der kein Vogel brüten mag und keine Biene summt.
Bei den gepflanzten Sträuchern sollte man möglichst heimische Arten ausgewählen. Als wichtigste Insektensträucher, die zahlreiche Falter, Hummeln und Wildbienen anlocken und als Futterpflanzen für Schmetterlingsraupen dienen, sind zu nennen:
- Schlehe
- Faulbaum
- Salweide
- Reifweide
- Lorbeerweide
Heimische Laubbäume

Wer Platz hat, tut auch viel für die Natur, wenn er einen Bestand ökologisch wertvoller heimischer Laubbäume pflanzt. Von Größe und Standort her kommen Eiche, Pappel und Erle im Garten meist nicht in Frage. Doch andere heimische Laubbäume eignen sich bestens:
- Birke
- Hainbuche
- Vogelbeere (Eberesche)
- Gartenapfel
- Birne
- Pflaume
Obstbäume sind von hoher ökologischer Bedeutung für die heimische Tier-, Vogel und Insektenwelt. Die Beeren der Eberesche sind eine wichtige Nahrungsquelle für zahlreiche Vogelarten.
Gemüse

Im März und April ist es Zeit, Pflanzen vorzuziehen, beispielsweise auf der warmen Fensterbank:
- Sommerblumen, Paprika, Auberginen und Tomaten brauchen viel Sonne und mehr als nur frühlingshafte Temperaturen.
- Pflanztöpfe lassen sich aus alten Zeitungen, Kartons oder Eierschalen ganz leicht selbst basteln und müssen nicht zugekauft werden.
Viele Samen können im April auch direkt im Garten gesät werden:
- Rettich, Radieschen, Möhren, Mangold, Erbsen und Rote Beete,
- Kartoffeln, auch solche aus der Küche, die schon zu keimen begonnen haben,
- Kohlrabi, Blumenkohl und verschiedene Salatarten.
- Haben Sie noch ein Plätzchen frei im Garten? Dann stecken Sie doch Knoblauchzehen in die Erde.
Heimstätten für Reptilien und Käfer

Bieten Sie Nützlingen einen Garten, in dem sie sich auch verstecken können, denn in einem aufgeräumten Garten fühlen sie sich nicht wohl. Ein zusätzlicher Komposthaufen mit viel holzigem, größerem Material oder Haufen aus Holzrugeln, Rinde und Wurzelstücken eignen sich für die Larven vieler Käferarten, Tausendfüßler und anderer Insekten. Auch das hilft ihnen in Zeiten des Insektensterbens. Außerdem fühlen sich dort ebenso Wirbeltiere wie Igel, Blindschleiche und Ringelnatter wohl.
So legen Sie einen Totholzhaufen an
- Wählen Sie für den Reisig- oder Totholzhaufen einen ruhigen Ort im Garten, den Sie auch in den nächsten Jahren nicht anders verwenden werden.
- Verwenden Sie für den Haufen abgestorbene Zweige, Äste, Wurzeln und Laub.
- Stapeln Sie das beim Gartenschnitt angefallene Totholz locker aufeinander, sodass Hohlräume entstehen können.
- Fügen Sie hier und da Laub mit ein und/oder verteilen Sie es über dem Haufen.
- Schichten Sie wieder Totholz nach, wenn der Haufen nach ein paar Monaten schon stark zerfallen sein sollte.







