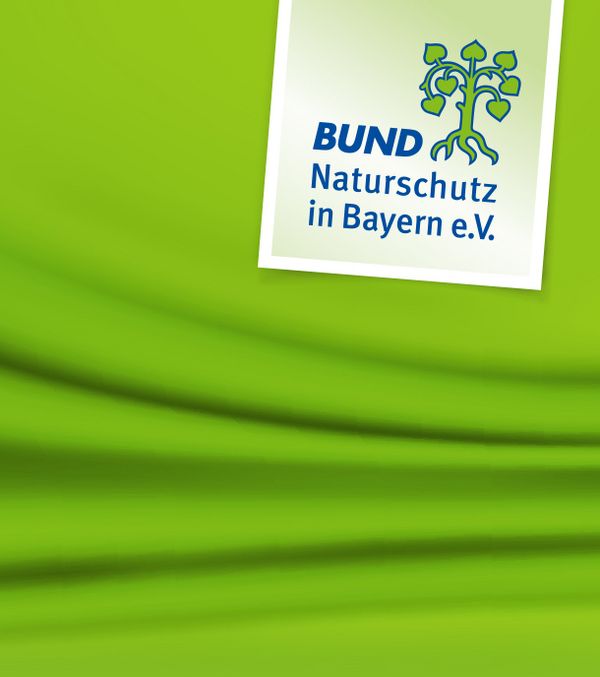- Home ›
- Themen ›
- Natur und Landschaft ›
- Stadt als Lebensraum ›
- Stadtbäume
Stadtbäume: Wichtiger denn je!
In Zeiten des Klimawandels werden Stadtbäume immer wichtiger für uns: Sie produzieren Sauerstoff, verbrauchen klimaschädliches Kohlendioxid und kühlen die Luft. Trotzdem wurden zwischen 2012 und 2022 300.000 Stadtbäume in Bayern gefällt. Im Sommer wird es dadurch noch heißer in unseren Städten. Zeit für eine Trendwende!

Stadtbäume sind "Alleskönner": Sie speichern klimaschädliches Kohlendioxid, liefern Sauerstoff, kühlen und reinigen die Luft, spenden Schatten an heißen Tagen, dämpfen Umgebungslärm, beherbergen Eichhörnchen, Grünspecht und Co. und – sie tun uns einfach gut! Schon der Anblick von Grün in der Stadt reicht, damit sich Menschen besser fühlen und der Stresspegel sinkt.
-21.600
Bäume in München
-10.000
Bäume in Nürnberg und Würzburg
-2.680
Bäume in Regensburg
Doch trotz dieser unschlagbaren Positivbilanz verschwinden Jahr für Jahr viel zu viele Bäume für immer aus dem Stadtbild. 300.000 waren es in Bayern zwischen 2012 und 2022. Das hat die Hochrechnung einer Umfrage ergeben, die der BUND Naturschutz im heißen Sommer 2022 in den 15 größten bayerischen Städten und den sieben Regierungsbezirksitzen durchgeführt hat. Was wenig wundert: Die Bäume sind vor allem Bauvorhaben zum Opfer gefallen. Auch hier zeigt sich, dass Bayern mit seinem wildwuchernden Flächenverbrauch die Existenzgrundlagen der kommenden Generationen gefährdet.
So positiv wirken Stadtbäume
Bäume sind hervorragende Klimaschützer: Sie produzieren Sauerstoff und verbrauchen dabei klimaschädliches Kohlendioxid. So kann beispielsweise eine einzige ausgewachsene Buche Tag für Tag den Sauerstoff für bis zu 50 Menschen erzeugen – ohne Steckdose und völlig kostenlos noch dazu!
Laubbäume verdunsten an heißen Sommertagen bis zu 400 Liter Wasser und entziehen dabei der umgebenden Luft Wärme.
Bäume verbessern vor allem in Stadtzentren und engen Straßen die Luftqualität entscheidend: Sie filtern dank ihrer großen Blattoberflächen sowohl Fein- und Grobstäube als auch giftige Stickoxide aus der Luft und reduzieren damit die Konzentration gesundheitsschädlicher Stoffe in der Atemluft der Stadtbewohner. So tragen sie wesentlich zu einem gesünderen Wohnumfeld bei. Wo (in Städten) Bäume fehlen, kann der Schadstoffgehalt in der Luft gleich dreimal höher liegen als in baumgesäumten Straßenzügen!
Wenn mal wieder kein Wölkchen am Himmel und kein wohltuender Gewitterregen in Aussicht ist, beschatten vor allem großkronige Laubbäume Asphaltflächen und benachbarte Hausfassaden und bremsen damit höchst wirksam deren weitere Aufheizung. Ein Laubbaum mit gerade einmal 15 Meter Kronendurchmesser kann dabei eine Fläche von 160 Quadratmetern mit seinem Schatten kühlen. Und: Wo Bäume ihren Schatten werfen, erscheint uns Menschen die Lufttemperatur gleich um mehrere Grad niedriger und damit viel weniger belastend als das Thermometer anzeigt!
Stadtbäume werden in Zukunft noch wichtiger für uns: Der BUND Naturschutz hat im heißen Juli 2022 an verschiedenen Stellen in München Temperaturen gemessen. Die klare Bilanz: Die höchsten Temperaturen herrschten auf den versiegelten, baumlosen Plätzen in den Innenstadtbezirken. So kletterte das Quecksilber auf dem baumlosen Marienplatz auf 35,1 Grad, während in einer Alleestraße in Sendling 33,4 und im Englischen Garten sogar nur 32,1 Grad erreicht herrschten.

Baumschutz-Telefon: Rufen Sie an!
Sie haben Fragen rund ums Thema Baumschutz? Hier sind Sie richtig: Egal, ob es um die Verkehrssicherheit von Bäumen, den Baumschutz auf Baustellen, eine Baumfällung oder Nachbarschaftsstreitigkeiten geht: Das Baumschutz-Telefon hilft. Montag bis Donnerstag, 9 bis 13 Uhr, kostenfrei unter 0800/stadtbaum (0800/7823822) oder unter stadtbaum@bund-naturschutz.de.
Für eine deutliche Verbesserung des Stadtklimas wäre nach einer Studie der TU München ein Anteil von 30 bis 40 Prozent von Grünflächen in Stadtgebieten notwendig. Das erscheint angesichts der Bautätigkeit und des Flächenverbrauchs in bayerischen Städten zwar utopisch – ein konsequenter Baumschutz wäre aber immerhin ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Besonders erschreckt hat die BN-Experten, dass zum Teil sehr alte und große Bäume weichen mussten, obwohl sie noch gesund waren. Denn: Nachpflanzungen können den Verlust eines alten Baumes nur schwer ausgleichen. So wächst beispielsweise ein Linde maximal 25 bis 50 Zentimeter pro Jahr. Es dauert also durchschnittlich 25 Jahre bis eine neu gepflanzte Linde die mittlere Höhe von zehn Metern erreicht – in Städten oft sogar länger, weil die Wurzeln wenig Platz haben. Den vollen Umfang der positiven Effekte eines alten Baumes erreicht ein Baum dieses Alters aber auch dann noch lange nicht.
Nur wenig Baumschutzverordnungen

Bislang gilt im Freistaat keine Verpflichtung für Städte und Gemeinden, den Baumbestand im Ortsgebiet über eine sogenannte Baumschutzverordnung zu erhalten. Diese regelt, welche Bäume schützenswert sind. Aber: Kaum eine Kommune hat solche Verordnung. Erst in 94 der 2.056 bayerischen Städte und Gemeinden existiert eine kommunale Baumschutzverordnung. In allen anderen Kommunen haben Bäume keinerlei Schutz. Fehlt eine Baumschutzverordnung bleibt es den Eigentümern überlassen, was sie mit ihrem Baum tun.
Die größte Gefahr für Bäume ist allerdings das Baurecht, denn "Baurecht schlägt Baumschutz". Das Baurecht ist immer vorrangig – Bäume müssen in aller Regel weichen. In Bebauungsplänen kann aber der Erhalt von Bäumen oder eine Neuanpflanzung festgesetzt werden. Wenn es außerdem eine Baumschutzverordnung in der Kommune gibt, können Ersatzpflanzungen und/oder Ausgleichszahlungen in der Baugenehmigung zur Auflage gemacht werden.
Unerlaubte Baumfällung – was tun?
Erster Schritt
Fragen Sie die an den Vorbereitungen zur Fällung beteiligten Arbeiter oder deren Vorarbeiter nach der Fällgenehmigung und bitten sie darum, diese sehen zu dürfen.
Zweiter Schritt
Falls der Fälltrupp keine Genehmigung vorlegen kann, fragen Sie nach der für die Fällung verantwortlichen Person und rufen Sie diese sofort an.
Dritter Schritt
Falls Sie den begründeten Verdacht haben, dass es sich um eine illegale Fällaktion handelt, rufen Sie die Polizei an. Machen Sie dabei deutlich, dass akuter Handlungsbedarf besteht.
Angesichts der ermittelten Baumverluste und dem fortschreitenden Klimawandel ist der BUND Naturschutz überzeugt, dass Freiwilligkeit in puncto Baumschutzverordnungen nicht mehr ausreicht: Ein gesetzlich vorgeschriebener Baumschutz, kühlende Grünflächen und Nachpflanzungen, falls Fällungen tatsächlich nicht vermieden werden können, müssen künftig Teil der Bauplanung werden.
Bei ihrer Recherche haben die Experten des BN außerdem eine chaotische Datenlage vorgefunden. Es gibt keine verlässlichen Angaben, was den Baumbestand in Kommunen angeht. Der BUND Naturschutz fordert deshalb ein Baumkataster, das künftig einen lückenlosen Überblick über Fällungen und Neupflanzungen in Kommunen gibt.
Das harte Leben der Stadtbäume

Stadtbäume sind einer Vielzahl von Belastungen wie Hitze, Autoverkehr, Wassermangel und Nährstoffarmut ausgesetzt. Aufgrund dieser schwierigen Standortbedingungen liegt ihre Lebenserwartung um 50 Prozent niedriger als die ihrer Kollegen in der freien Natur, bei Straßenbäumen sogar um 75 Prozent. So führen das Begehen und Befahren der Baumscheiben sowie deren zeitweise Nutzung als kostenlose Abstellfläche zur Verdichtung des Bodens um den Baumstamm und in der Folge zu einer schlechteren Wasser- und Nährstoffzufuhr.
Im ungünstigsten Fall reichen Pflaster oder Teerbelag sogar unmittelbar bis an den Stamm eines Stadtbaumes heran. Der Baum wird nicht mehr ausreichend mit Wasser und Nährstoffen versorgt und seine Vitalität damit erheblich beeinträchtigt. Er wird anfälliger für Krankheiten sowie Parasiten und kann Tausalz- und Abgasbelastung oder einen massiven Rückschnitt in der Folge oft nicht mehr ausgleichen.
Hundeurin schädigt Stadtbäume
Hunde lieben es, an Bäumen ihre "Nachrichten" für die Artgenossen zu hinterlassen. Doch der saure Hundeurin verursacht an der Baumrinde Ätzschäden, die sogar zum Ablösen der Rinde führen können. An solchen Schadstellen dringen dann Krankheitserreger, teilweise auch schmarotzende Pilze in den Stamm ein. Fäulnisschäden sind die Folge, durch die sogar die Standfestigkeit eines Baumes gefährdet werden kann.
Auch Streusalz setzt Stadtbäumen schwer zu. Es behindert die Wasseraufnahme und verändert den Nährstoffhaushalt. Kleine Blätter, Braunfärbung der Blattränder und frühzeitiger Laubfall sind die Folgen. Vor allem Linde, Ahorn, Rosskastanie und Roteiche reagieren sehr empfindlich auf die durch Streusalz verursachte Erhöhung der Ionen-Konzentration im Boden. Sie hat eine fatale Auswirkungen auf die Lebenserwartung von Straßenbäumen.
Häufig werden Stadtbäume mit dem vorgeschobenen Grund "Verkehrssicherheit" gekappt, das heißt, mehr oder weniger die gesamte Baumkrone wird entfernt. Das hat fatale Folgen, denn Kappungen haben nichts mit Baumpflege zu tun! Vielmehr wird der Baum dadurch zu einem teuren "Dauerpatienten". Um einen gekappten Baum verkehrssicher und ästhetisch zu erhalten, ist es oft nötig, im Abstand von drei bis fünf Jahren Nachbehandlungen durchzuführen. Dies führt zu einem hohen (finanziellen) Aufwand. Nicht selten muss der Baum dann trotzdem lange vor der Zeit gefällt werden.
Nach einer Kappung versucht der Baum, durch unkontrolliertes Triebwachstum die verlorene Photosynthesefläche wiederherzustellen. Die Anbindung der neuen Triebe an den Holzkörper des Baumes und das Holz dieser in kürzester Zeit gebildeten Äste ist qualitativ schlechter. Außerdem können diese Triebe innerhalb einer Vegetationsperiode über einen Meter in die Länge wachsen. So erreicht der Baum in wenigen Jahren wieder seine ursprüngliche Größe. Die natürliche Kronenstruktur bleibt jedoch langfristig zerstört.
Wurzeln sterben ab
Die Kappung eines Baumes führt außerdem zu einem starken Wurzelverlust, denn die Krone des Baumes versorgt die Wurzeln mit lebensnotwendigen Assimilaten. Schneidet man einen Großteil der Krone ab, werden die Wurzeln nicht mehr versorgt und sterben ab. Der Baum kann sich dadurch schlechter mit Wasser und Nährstoffen versorgen und ist schlechter im Boden verankert.
Überdies können in die großen Schnittwunden nach einer Kappung leicht holzzersetzende Pilze in den Baum eindringen. Sie lösen Fäule im Holz aus, die die Statik des Baumes beeinträchtigen. Fazit: Es gibt immer eine bessere Lösung als eine Kappung!
Baustellen: Große Gefahr für Stadtbäume

Die Erschließung neuer Baugebiete und Straßen bedeutet in der Regel für etliche Bäume das Todesurteil, denn fast immer steht dabei irgendein viele Jahrzehnte gewachsener Baum (oder gleich mehrere) im Wege. Umso wichtiger ist es deshalb, dass zumindest diejenigen Bäume, die auf einer Baustelle erhalten werden können, während der Bauphase vor vermeidbaren Schäden wirksam geschützt werden! So wirken Baugruben oft wie eine Drainage und entziehen nahliegenden Bäumen lebensnotwendiges Wasser. Auch Baumverletzungen durch Baumaschinen und Bodenverdichtung sind ein großes Problem.
Schutzvorkehrungen bei Baumaßnahmen
Für das direkte Baumumfeld gilt prinzipiell:
- Nicht befahren
- Kein Ablagern von Treibstoff, Chemikalien, Baumaterialien, Baustelleneinrichtung
- Schwenkbereich beachten (z. B. Kran)
- Baumkrone schützen
- Kein Bodenabtrag
- Keine Aufschüttung
- Nicht verdichten
- Keine Leitungsverlegung
Angaben darüber, welche Schutzvorkehrungen bei Baumaßnahmen möglich und notwendig sind, finden sich in mehreren Regelwerken:
- DIN 18920, Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen,
- RAS-LP4, Richtlinie für die Anlage von Straßen, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen,
- ZTV-Baumpflege, "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege",
- Baumschutzverordnung der einzelnen Kommunen.
Die notwendigen Schutzmaßnahmen für Bäume im Baustellenbereich werden üblicherweise als Auflage in der Baugenehmigung durch die Genehmigungsbehörde (z. B. Bauamt der Stadt bzw. Landratsamt) festgesetzt.
Verkehrssicherungspflicht: Keine Angst vor großen Bäumen!

Laut eines Grundsatzurteils des Bundesgerichtshofes müssen alle Baumeigentümer – egal ob Privatpersonen oder Kommunen – sicherstellen, dass von ihren Bäumen für andere Personen keine Gefahr ausgeht. Soweit erforderlich müssen von den jeweiligen Baumeigentümern zur Schadensvorbeugung beziehungsweise -abwehr gegenüber Dritten Schutzvorkehrungen getroffen werden. Darum ist es geboten Bäume regelmäßig zu kontrollieren, darüber schriftliche Aufzeichnungen anzufertigen und diese aufzubewahren.
Eine übergroße Angst des Baumeigentümers, des Baumpflegers oder Baumkontrolleurs vor der Haftung für Schäden durch Bäume ist weitgehend unbegründet. Weder der verantwortungsvoll handelnde Baumeigentümer, der neben der Baumkontrolle auch eine fachgerechte Baumpflege veranlasst, noch der fachlich korrekt arbeitende Baumpfleger oder Baumkontrolleur kann ohne weiteres zur Verantwortung für Schäden durch einen Baum herangezogen werden. Auch der gesunde Baum kann versagen und manches Versagen ist eben nicht vorhersehbar.