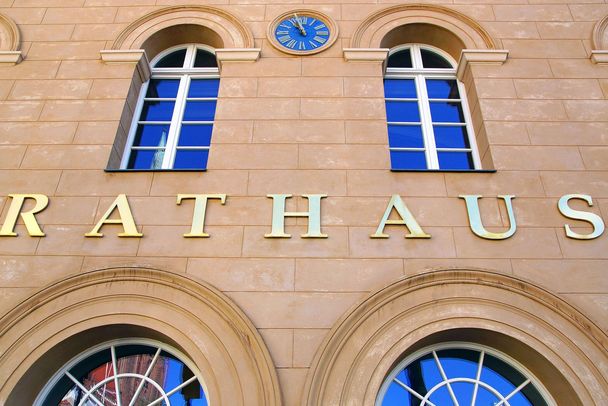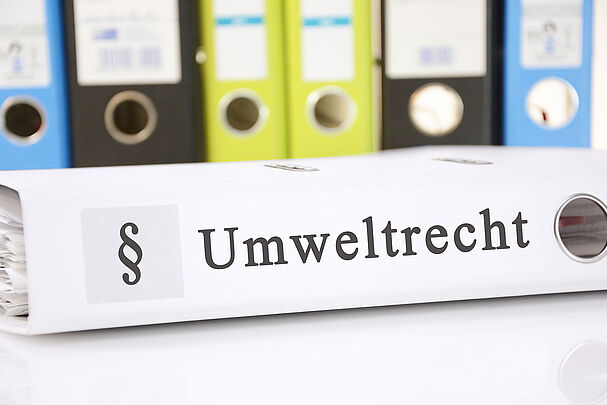Umweltpolitik – so spannend wie praktischer Naturschutz
Umweltpolitik hat viele Facetten, sie ist ein wichtiges Instrument des Naturschutzes. Der BUND Naturschutz in Bayern e.V. setzt sich mit allen Kräften dafür ein, die Interessen des Umweltschutzes auch politisch zu vertreten. Die Möglichkeiten reichen von öffentlichen Aktionen über Lobbyarbeit bei Regierungen, Behörden und in der Wirtschaft bis hin zu Beteiligungsprozessen, Stellungnahmen oder der Verbandsklage: Es gilt, Umweltbelange bei politischen Entscheidungsträgern zu Gehör zu bringen.
Der BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) schützt die Natur. Zum einen legen seine Mitglieder selbst Hand an, wenn sie Amphibien dabei helfen gefährliche Straßen zu überqueren, bei der Mahd von Streuwiesen anpacken oder den Bestand von Tieren und Pflanzen dokumentieren. Doch daneben wird dieses praktische Engagement durch umweltpolitische Arbeit auf allen Ebenen flankiert – um die Erfolgschancen zu maximieren. Dazu nutzt der BN sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Mittel, von der medienwirksamen und öffentlichen Aktion über die Teilnahme an Runden Tischen und Initiativen bis hin zur Wahrnehmung von Beteiligungs- und Klagerechten gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) beziehungsweise dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG).
Eine BN-Kundgebung auf dem Marktplatz zum Flächenschutz, mit der ein neues Gewerbegebiet auf der grünen Wiese verhindert werden soll, trägt zum Erhalt von Lebensraum bei. Sie zählt somit ebenso zur Umweltpolitik wie die Unterstützung des „Volksbegehrens für Artenvielfalt“ – und der kritische Blick auf die Umsetzung der Ziele durch die Bayerische Staatsregierung.
Umweltpolitik kurz erklärt
Umweltpolitik dient dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Sie betrifft somit jede und jeden, der Ressourcen verbraucht oder belastet: Als Verkehrsteilnehmer trage ich etwa unter anderem zum Flächenverbrauch und zur Luftbelastung bei, als Landwirt nutze ich die Ressource Boden, in Fabriken entsteht Abwasser, das den Lebensraum in Flüssen und Seen beeinträchtigen kann. Von uns gewählte Politiker tragen zum Beispiel mit der Umweltgesetzgebung dazu bei, die Eingriffe auf ein vertretbares Maß zu beschränken. Doch dazu benötigen sie Expertise aus der Wissenschaft und Resonanz aus der Zivilgesellschaft, insbesondere den Umwelt- und Naturschutzverbänden. Die folgenden drei Prinzipien sind die wichtigsten und sollen die Politik bei der Umsetzung leiten:
- Vorsorgeprinzip: Die Politik ist aufgerufen, Umweltgefahren vorauszusehen und im Voraus Maßnahmen zu ergreifen, um mögliche Schäden zu verhindern.
- Verursacherprinzip: Sollte es dennoch zu Umweltschäden kommen, so haftet der Verursacher und nicht die Allgemeinheit.
- Kooperationsprinzip: Es fordert direkte Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, Lösungen sollen einvernehmlich erfolgen und die Interessen aller gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigen.
Es ist bekannt und offensichtlich, dass diese Vorgaben regelmäßig nicht eingehalten werden (können), Umwelt und Natur geschädigt werden. Umso mehr braucht es Verbände wie den BN, die diesen Auftrag immer wieder einfordern und die staatlichen Institutionen auf Missstände aufmerksam machen.
Es sind bei weitem nicht nur Politiker, die "Umweltpolitik machen". Neben den staatlichen – zum Teil internationalen – Institutionen und Behörden wie Umweltministerien oder Umweltämtern dürfen die zivilgesellschaftlichen Organisationen wie auch die einzelnen Bürger – etwa in Bürgerbeteiligungsverfahren – nicht vergessen werden. Umweltpolitik liegt "quer" zu zahlreichen anderen Politikfeldern, insofern kommen sehr viele Akteure mit dieser Querschnittsaufgabe in Berührung:
- staatliche Institutionen wie Ministerien und Behörden: neben dem Umweltministerium "machen" also beispielsweise auch das Verkehrs- oder das Landwirtschaftsministerium Umweltpolitik. Behörden wie das Umweltbundesamt oder das Bayerische Landesamt für Umwelt liefern die wissenschaftliche Expertise, auf deren Grundlage die Regierung Entscheidungen treffen kann
- Nicht-Regierungsorganisationen und Verbände wie der BUND Naturschutz e.V., Greenpeace, NABU oder WWF
- engagierte Bürger bringen sich auf Demonstrationen ein, organisieren sich in Bürgerinitiativen oder nehmen an Bürgerbeteiligungsverfahren teil
Der BN setzt sich für Natur- und Artenschutz ein, praktische Aktionen – etwa die Sicherung von Amphibienwanderwegen bis hin zu Auswilderungsprojekten – gehen Hand in Hand mit einem breiten Engagement auf gesellschaftlicher und politischer Ebene. Mehr über Aufbau und Organisation des BN lesen.
Erfolgreiche Umweltpolitik mit den richtigen Instrumenten

Um umweltpolitische Ziele zu erreichen, bedienen sich die Akteure unterschiedlicher Instrumente: Mit der ökologischen Steuerreform beispielsweise setzte die damalige rot-grüne Bundesregierung Anreize für energiesparendes Verhalten – und quasi jeder Bürger ist von dem Gesetz betroffen. Im Hafenlohrtal hingegen war es die Kreisgruppe Main-Spessart, die zunächst eine Aktionsgemeinschaft gegen den Bau des geplanten Speichersees initiierte und das Projekt dann über die Region hinaus bekannt machte – bis der Plan von der Bayerischen Staatsregierung schließlich aufgegeben wurde.
Welche umweltpolitischen Instrumente gibt es? Wie nutzt sie der BN?
Der BN bringt seine Expertise zu Natur- und Umweltschutz an die breite Öffentlichkeit. Pressemitteilungen erreichen neben Multiplikatoren aus den Medien auch Politiker. Mit Flyern zu aktuellen Hotspots, Publikationen wie BN informiert oder der BN Position werden Themen und Hintergründe verständlich erklärt. An Infoständen und über die BN-Website wird nicht nur um neue Mitglieder und Spenden geworben, sondern auch über Naturschutzanliegen und konkrete Vorhaben informiert. In Meinungsumfragen werden Stimmungsbilder der Bevölkerung ermittelt, regelmäßig werden auch Unterschriften für Petitionen gesammelt (siehe unten).
Der BN organisiert Mahnwachen oder Demonstrationen zu aktuellen Anlässen, etwa für die freifließende Salzach, den Jahrestag von Fukushima oder die Forderung nach einer Ernährungswende (Mia hams satt!).

Der BN nimmt an Beteiligungsprozessen und Runden Tischen teil, startet selbst Initiativen für die Bündnisarbeit mit anderen Naturschutzverbänden, Gewerkschaften, Sozialverbänden oder Bürgerinitiativen. Gemeinsam werben sie dafür, Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung wahrzunehmen, etwa im Zuge von Raumordnungsverfahren wie zum geplanten Bau eines ICE-Werks im Nürnberger Reichswald, der verhindert werden konnte. Der BN und seine Bündnispartner stellen hier auch Studien und Konzepte mit Vorschlägen vor oder machen – im Fall des ICE-Werks beispielsweise mit dem Alternativstandort Nürnberger Hafen – konkrete, praktische Empfehlungen für naturverträgliche Lösungen. Im Modellprojekt "Umgehungsstraßenbau statt Ortsumfahrungen" (BN Informiert, PDF) wiederum arbeitete der BN – etwa über den Bürgerbeteiligungsprozess – mit dem bayerischen Verkehrsministerium zusammen.
Der BN begleitet politische Versammlungen und Kongresse, er nimmt zum Beispiel an internationalen Klimakonferenzen oder an Parteitagen teil. Solche Veranstaltungsbesuche gibt es auf allen Ebenen, hier geht es darum, Entscheidungsträger direkt anzusprechen und für Naturschutzinteressen zu gewinnen.
Die Stellungnahmen des BN liefern darüber hinaus wichtige Argumente für oder gegen eine geplante Maßnahme, zum Beispiel in Bau- und Genehmigungsverfahren. Derartige Stellungnahmen sind für viele politische Abläufe vorgeschrieben, besondere Bedeutung hat hier das Landesentwicklungsprogramm (LEP).
Die Petition ist eine offizielle Forderung, die von Einzelpersonen oder Gruppen formuliert und an den Bayerischen Landtag gerichtet ist. Sofern das Anliegen in dessen Zuständigkeit fällt, bearbeitet der Petitionsausschuss den Antrag und leitet ihn an die Staatsregierung weiter. Durch das Grundrecht auf Petitionen erhält jede Person die Möglichkeit, sich „gegen Benachteiligungen, ungleiche Behandlung oder Ungerechtigkeiten durch Behörden oder Einrichtungen des Freistaats Bayern zu wehren“ (Bayerischer Landtag zu Petitionen).
Schon als Einzelperson können Sie eine Einzelpetition einreichen, eine Sammelpetition verleiht dem Anliegen von Beginn an mehr Gewicht. Dazu ist eine Unterschriftenliste nötig, für die der BN regelmäßig bei Unterschriftensammlungen wirbt. Zusammen mit anderen Organisationen startete der Landesverband des BN beispielsweise die Petition für eine Verbesserung des Regionalsiegels „Qualität aus Bayern“. Doch auch BN-Kreisgruppen (KG) nutzen das Instrument aktiv, etwa die KG Landsberg am Lech gegen eine Intel-Chipfabrik.
In unserem Rechtssystem gilt der Grundsatz, dass nur derjenige zur gerichtlichen Klage berechtigt ist, der unmittelbar von einer Handlung betroffen ist, die ihn beeinträchtigt oder schädigt. Mit der Verbandsklage jedoch haben auch Verbände die Möglichkeit erhalten, zum Beispiel im Namen von Umwelt und Natur zu klagen. Der BN nutzt diesen Weg, wo immer es sinnvoll erscheint.
Doch das Spektrum von rechtlichen Eingriffsmöglichkeiten reicht weiter, wie die erfolgreichen Verfassungsbeschwerden gegen das damalige Klimaschutzgesetz der Bundesregierung im April 2021 gezeigt haben: Eine Reihe von jungen Menschen hatte zusammen mit mehreren Umweltschutzorganisationen Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt und wirksame Generationengerechtigkeit in Form von mehr Klimaschutz gefordert. Das Verfahren wurde als Klimaklage bekannt, das Gericht gab den Klägern recht und die Regierung musste ihre Klimaschutzziele verschärfen.
Ob Person oder Unternehmen: hierzulande ist jedermann aufgefordert, die Umwelt nicht zu verschmutzen oder zu beeinträchtigen. Kommt es doch zu einem Schaden, etwa in einem Biotop oder bei einer geschützten Tier- oder Pflanzenart, so wird der Verursacher nach dem Umweltschadengesetz aufgefordert, für die Renaturierung zu sorgen. Zuständig für das „Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden“ sind die lokalen Behörden wie Landratsämter. Doch auch Umweltverbände wie der BN haben das Recht, die nötigen Maßnahmen zur Sanierung vor Gericht einzuklagen. Oder der BN erhöht den Druck auf die Behörden, etwa durch einen Appell als Unterschriftenaktion, um die Verantwortlichen für die Zerstörung des Rappenalptals im Allgäu zur Verantwortung zu ziehen.
Regierung und öffentliche Verwaltung verfügen regelmäßig über Hintergrundwissen – beispielsweise in Form von Daten –, die sie nicht standardmäßig veröffentlichen. So schützen sie beispielsweise Unternehmen vor kritischen Nachfragen, können aber auch selbst leichter eigene Vorhaben verfolgen. Solange jedoch Außenstehenden nicht bekannt ist, auf welcher Basis Entscheidungen getroffen werden, solange können weder Umweltfolgen realistisch abgeschätzt werden, noch können Aktive die Interessen des Naturschutzes vertreten. Der BN stellt daher Anfragen an relevante Gremien und Behörden und nutzt dazu das Umweltinformationsgesetz (UIG), wonach die öffentlichen Stellen auskunftspflichtig sind. Der BN ermöglicht durch diese Recherchen Transparenz für die Öffentlichkeit, beispielsweise über Messdaten zur Luft- oder Wasserqualität, darüber wie Umweltgesetze umgesetzt werden, oder zur landwirtschaftlichen Produktion von Lebensmitteln.
Für erfolgreiche Umweltpolitik müssen oft mehrere Instrumente zusammen genutzt werden. Gerade Großprojekte – beispielsweise Donauausbau durch Staustufen vs. freifließende Donau – betreffen viele gesellschaftliche Bereiche und Anliegen. BN-Aktionen setzten hier seit den 1990er-Jahren verschiedene Hebel an: Angefangen bei der Entwicklung alternativer Ausbauvarianten über die Meldung von Natura2000-Schutzgebieten und den Erwerb von Sperrgrundstücken bis hin zu den Donaufesten, auf denen viele Menschen von der Notwendigkeit des Anliegens überzeugt werden konnten. Die Ziele von Naturschützern und BN können nur dann erreicht werden, wenn viele politische Ebenen gleichzeitig bearbeitet werden (siehe Beispiele unten).
Auszug aus: Sebastian Fritsche. „Welche Einflussmöglichkeiten haben Umweltverbände auf die deutsche Politik? Eine Darstellung am Beispiel des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland)." iBooks
Die verschiedenen Handlungsebenen von Umweltpolitik
Die Devise „global denken, lokal handeln“ ist den meisten Umweltinteressierten vertraut. Doch zum Teil ist es erfolgversprechender, sich auf einer höheren Ebene zu engagieren – in der Regel als Zusammenschluss mehrerer Umweltverbände und Interessengruppen –, um zum Ziel zu kommen. So spricht der BN zwar nicht vor der UN-Vollversammlung, er – beziehungsweise seine Vertreter – setzt sich aber nicht nur für konkrete Naturschutzanliegen in Bayern, sondern auch auf internationalen Konferenzen für globale Abkommen ein:
- Der BN sorgt für die öffentliche Wahrnehmung von Umwelt- und Naturschutzthemen: Ob Aktion, Demo oder Flyer, der BN informiert nicht nur die Öffentlichkeit sondern auch die politischen Entscheidungsträger über (komplexe) Hintergründe und Anliegen des Natur- und Umweltschutzes.
- Der BN sucht den direkten Kontakt zu politischen Entscheidungsträgern, erläutert Zusammenhänge und vermittelt wissenschaftliche Expertise (Lobbying).
- Der BN nutzt die rechtlichen Instrumente, etwa die Verbandsklage, um Natur- und Umweltschutz durchzusetzen.
Ob Ehrenamtliche in der Jugendorganisation Bund Naturschutz (JBN), in der Kreisgruppe oder Hauptamtliche im Landesverband: Der BN initiiert und unterstützt lokale Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit um politische Entscheidungsträger auf Umweltbelange aufmerksam zu machen. Darüber hinaus sucht der BN den direkten Kontakt zu den Amtsträgern. Als anerkannter Naturschutzverband wird der BN zudem regelmäßig von Behörden um Stellungnahmen gebeten, um beispielsweise im Zuge von Planfeststellungsverfahren geplante Baumaßnahmen zu bewerten. Dank der Expertise der BN-FachreferentInnen, treten hier nicht selten wichtige Argumente zutage, die zum Beispiel ausschlaggebend sein können, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist und eingeleitet wird, oder nicht. BN-Referenten, Facharbeitskreise und Vorstände erarbeiten, bündeln und formulieren also Forderungen, die sich je nach Umweltproblem an Gemeinde, Markt oder Stadt (darüber Landkreis und Bezirk) richten:
- BN-Orts- und Kreisgruppen schaffen Öffentlichkeit
- organisieren Aktionen und Kundgebungen
- informieren Stadträte oder Bürgermeister
- fordern Entscheidungen und Maßnahmen für Umwelt- und Naturschutz
Einfluss auf die Bundespolitik nimmt der BN sowohl über seinen Dachverband BUND – Friends of the Earth, als auch über die bayerischen Bundestagsabgeordneten sehr direkt. Da die Natur, Tiere und Pflanzen, aber keine Landesgrenzen kennen und wesentliche Rahmenbedingungen für Umweltpolitik auf Bundesebene beschlossen werden, werden viele Ziele auch bundesländerübergreifend verfolgt. Dazu zählt beispielsweise das Projekt Grünes Band, das entlang der ehemaligen Grenze zwischen DDR und BRD einen wichtigen Beitrag für zusammenhängende Lebensräume in Deutschland leistet – es ist übrigens der längste Biotopverbund der Welt. Um ein solches Gebiet auszuweisen und zu schützen, sind zahlreiche Schritte und eine Vielzahl von Entscheidungen nötig, die am besten im Verbund mit anderen Organisationen verfolgt werden.
Auf europäischer und internationaler Ebene ist der BUND – und damit auch der BN – Teil des weltweiten Netzwerks Friends of the Earth beziehungsweise Friends of the Earth Europe. Dazu gehört die Teilnahme an Demonstrationen, aber auch Lobbyarbeit und Mitwirkung an internationalen Konferenzen, etwa der COP28 in Dubai im Dezember 2023 zum Klimaschutz.
Außerdem nutzt der BN die Möglichkeiten des übergeordneten Rechtssystems, insbesondere natürlich der EU: Ein Beispiel wäre die „Beschwerde bei der EU-Kommission für wirksamen Feldhamster-Schutz“ im Jahr 2017: Hier sah der BN, dass ein Konzept des Freistaats Bayern zum wirksamen Erhalt der Vorkommen des europaweit geschützten Feldhamsters fehlte. Mit der Beschwerde soll der Druck vonseiten der höheren Ebene auf die bayerische Ebene erhöht werden, damit die Feldhamstervorkommen wirksam – und damit so, wie es die EU über die FFH-Richtlinie vorsieht – erhalten bleiben.
Und schließlich zählen auch Gespräche mit den Mitarbeitern des Europäischen Parlaments zur Umweltpolitik: Gerade im Natur- und Umweltschutzbereich kommen zentrale und sehr gute Vorgaben und Verpflichtungen für die Länder aus Brüssel.
Beispiele für die umweltpolitische Arbeit des BUND Naturschutz in Bayern e.V.

Es ist nicht übertrieben festzustellen, dass der Freistaat Bayern ohne den Einsatz des BN und seiner vielen Unterstützer*innen heute anders aussähe. Ein Beispiel ist der Verlauf der A94 bei Ampfing, zahlreiche weitere Beispiele, die dies belegen, finden sich unter Erfolge und Niederlagen. An dieser Stelle soll jedoch exemplarisch die Bandbreite der umweltpolitischen Arbeit dargestellt werden: Welche Stationen lassen sich nachvollziehen? Welche Schritte sind zu welchem Zeitpunkt sinnvoll?
Schritte: Gründung Bürgerbewegung > überregionales Interesse durch Sendung „Jetzt red i“ (BR-Fernsehen) > Lobbyarbeit bei Politikern > wissenschaftliche Expertise // parallel Öffentlichkeitsarbeit wie Hafenlohrtalfeste etc.
Ausgangslage 1976: Bayerische Landesregierung plant Trinkwasserspeicher im Hafenlohrtal, begründet dies mit steigendem Wasserverbrauch und bedenklichen Alternativquellen
- KG Main-Spessart gründet „Ökogruppe Hafenlohrtal“ gegen das Projekt, sie mündet 1978 in „Aktionsgemeinschaft Hafenlohrtal“ (AGH): eine von Beginn an starke Bürgerbewegung
- durch die BR-Sendung „Jetzt red’i“ wird im Anschluss an die Gründung der AGH überregionales Interesse für die Natur- und Kulturlandschaft geweckt, das 1. Hafenlohrtalfest zählt einige Monate später über 2.000 Besucher
- der Druck auf die Entscheidungsträger wächst: (regionale) politische Gremien verweigern sich den Ausbauplänen, etwa 1980 der Aschaffenburger Kreistag, dem schlossen sich die Regionalkonferenz Region 1 sowie die Regierung Unterfranken an, 1987 auch der Kreistag Main-Spessart
- das Thema wird an die Wissenschaft herangetragen, 1992 sprechen sich acht Biologie-Professoren der Würzburger Universität gegen den Stausee aus, es folgen die Chefs der Würzburger Stadtwerke
- September 2008: die Bayerische Staatsregierung gibt die Speicherpläne auf
Mehr zum Erfolg im Hafenlohrtal lesen.
Schritte: BN-Stellungnahme zu Planfeststellungsverfahren > Bürgerbegehren > Klage gg. Sofortvollzug > Gutachten/Studien zur Natur vor Ort > Klagen/Petitionen/Einwendungen bis hin zur Verfassungsbeschwerde // parallel Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit u.a. Demonstrationen zu Jahrestagen
- 2005/2006 leitet die Regierung Oberbayern ein Raumordnungsverfahren zum Bau der 3. Start- und Landebahn am Münchner Flughafen ein: im November reicht der BN bereits eine umfangreiche Begründung zur Ablehnung ein
- 2007 Einleitung Planfeststellungsverfahren, es werden 60.000 Einwendungen eingereicht, die BN-Stellungnahme umfasst 163 Seiten und reicht von verkehrs- und finanzpolitischen Argumenten bis zum Naturschutz etwa dem Erhalt des Erdinger Mooses
- 2010/2011 folgen Änderungen im Planfeststellungsverfahren (u.a. Bereich Naturschutz), Juli 2011 erlässt die Reg. Oberbayern Beschluss mit Sofortvollzug: die Unterschriftensammlung für Bürgerbegehren beginnt
- im Nov. reicht der BN Klage gegen Sofortvollzug ein, im Dez. Klage gegen das Hauptsache-Verfahren
- März 2012 wird der Sofortvollzug ausgesetzt: 1. Erfolg der Klage
- der Bürgerentscheid ergibt im Juni, dass 55 % der Münchner den Bau der 3. Startbahn ablehnen: der BN fordert die Gesellschafter zur Aufgabe der Pläne auf, dies wird abgelehnt, der Klageweg geht also weiter
- 2012/2013 wird die 3. Startbahn ins Landesentwicklungsprogramm als „Ziel“ aufgenommen
- 2013-2017 werden reihenweise Klagen, Petitionen und Einwendungen abgelehnt, der BN reicht schließlich Verfassungsbeschwerde ein. Parallel werden Jahrestage begangen – etwa 2015 „10 Jahre Widerstand gegen eine 3. Bahn“ gefeiert, oder im August 2022 zum 10. Jahrestag des erfolgreichen Münchner Bürgerentscheids demonstriert – um das Thema weiter der Öffentlichkeit zugänglich zu machen: die Mehrheit der Bayern ist gegen den Bau!
- 2018 verständigen sich CSU und FW im Koalitionsvertrag, die Pläne während der Legislaturperiode nicht weiterzuverfolgen: der BN fordert weiterhin konsequent die Aufgabe des Projekts
Mehr zum Widerstand gegen die Dritte Startbahn lesen.
2007 bescheinigt das Bundesamt für Naturschutz dem Buchenbestand im Steigerwald eine hohe Qualität. Das führt zur Idee, den Wald unter Schutz zu stellen und bei der UNESCO als Weltnaturerbe vorzuschlagen. Gegner fürchten u.a. um die regionale Holzwirtschaft.
- der BN setzt sich bei Meinungsträgern und in der Öffentlichkeit für den Nationalpark ein
- 2008 gründen Gegner wie Befürworter Bürgerinitiativen zum Steigerwald
- Gegner wie Befürworter kämpfen mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen, Unterschriftensammlungen und Studien um den Nationalpark Steigerwald
- der Bamberger Landrat Denzler weist 2014 das 775 Hektar große Schutzgebiet „Der Hohe Buchene Wald“ aus, Gegner lassen die Verordnung außer Vollzug setzen, das Naturschutzgebiet bleibt aber bestehen
- 2015 ändern Umweltministerium und Landtag das Naturschutzrecht, rechtsstaatlich fragwürdig gilt die Änderung rückwirkend, das Schutzgebiet soll abgeschafft werden.
- der Schutzstatus wird aufgehoben, der BN klagt dagegen, fürchtet großflächigen Einschlag alter Buchen. Zusammen mit dem LBV stellt er vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht einen Eilantrag gegen den Holzeinschlag, die Klage wird hier ebenso wie vom Bundesverwaltungsgericht abgelehnt: ein „Geschützter Landschaftsbestandteil“ sei nicht das richtige Instrument.
- 2016 stellt die Staatsregierung die Standorte Rhön und Spessart für einen dritten bayerischen Nationalpark vor, der Steigerwald wird ausgeschlossen
Seit Dezember 2018 werden im ehemaligen Schutzgebiet Bäume gefällt. Lesen Sie mehr zur aktuellen Entwicklung rund um den Steigerwald.